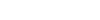Ausgleichsflächen
 Ausgleichsflächen - Wald oder Wiesen als Ersatz für Nachverdichtung durch Neubau
Ausgleichsflächen - Wald oder Wiesen als Ersatz für Nachverdichtung durch Neubau
Ausgleichsflächen helfen bei der nachhaltigen Planung und Nutzung von Flächen in städtebaulichen und infrastrukturellen Projekten. Sie dienen dem Ausgleich von Eingriffen in die Natur (z. B. durch Neubaubauvorhaben) und tragen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und ökologischen Funktionen bei. In vielen Fällen sind Ausgleichsflächen bei der Nachverdichtung bzw. Erweiterung oder Genehmigung von Wohnbaumaßnahmen oder der Neuausweisung von Gewerbegebieten gesetzlich vorgeschrieben. Damit wird sichergestellt, dass die negativen Auswirkungen von Eingriffen auf die Umwelt minimiert werden. In diesem Artikel werden wir Ihnen erläutern, was eine Ausgleichsfläche ist und wozu diese benötigt wird. Auch erfahren Sie, welche Arten von Ausgleichsflächen es gibt, welche Anforderungen an eine Ausgleichsfläche gestellt werden. Ebenso wissen Sie nach dem Lesen wer als Käufer solche Fläche sucht, braucht und kauft Zudem werden wir erklären was eine ökologische Aufwertung ist und wozu man diese braucht, wer die Einhaltung der Ausgleichsflächen überprüft sowie was ein Ökokonto ist. Außerdem werden wir Ihnen die Planung und das Verfahren aufzeigen, die Kosten einer Ausgleichsfläche darlegen und einige Beispiele für Ausgleichsmaßnahmen nennen.
Was ist eine Ausgleichsfläche und wozu ist diese wichtig?
Wenn bisherige landwirtschaftlichen Flächen (Wald, Wiese, Ackerland) im Umland von Gemeinden oder Städten bebaut, nachverdichtet oder versiegelt werden, verlangt der Gesetzgeber zunächst, dass dieser Eingriff in die Natur möglichst vermieden oder minimiert wird. Falls dies nicht möglich ist, muss der Eingriff zumindest ökologisch ausgeglichen werden. Dabei wird nun eine Ausgleichsfläche geschaffen, um die biologische Vielfalt und die ökologischen Funktionen zu erhalten.
Da es allerdings oft schwer ist, die versiegelten Flächen direkt wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, können an anderen Stellen einige Flächen ökologisch verbessert werden. Diese Flächen müssen nicht unbedingt innerhalb derselben Gemeinde liegen. Oftmals ist ein Radius von 30 km +/- um das Neubauvorhaben herum ausreichend. Die Details wissen die örtlichen Baubehörden.
Quelle: https://rosenheim.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/tuntenhausen/ausgleichsflaechen
Typen von Ausgleichsflächen
Es gibt verschiedene Typen von Ausgleichsflächen, welche je nach Art und Umfang des Eingriffs in die Natur sowie den ökologischen Bedürfnissen ausgewählt werden.
- Renaturierte Flächen: Diese Flächen werden wiederhergestellt, um ihre ursprüngliche natürliche Beschaffenheit zurückzuerlangen. Dazu gehört die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Auen oder Mooren, die durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wurden.
- Biodiversitätsflächen: Diese Flächen werden so gestaltet, dass die Artenvielfalt gefördert wird. Hier können naturnahe Wiesen, Hecken oder Bäume gepflanzt werden, welche Lebensräume für viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten bieten.
- Ausgleichsflächen für Lebensräume: Diese Flächen dienen dem Erhalt und der Verbesserung von Lebensräumen für spezifische Arten, welche durch das Bauprojekt bedroht werden (z. B. Vögel, Amphibien oder Insekten).
- Ökologische Ausgleichsflächen im Bereich Landwirtschaft: Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die in eine naturnahe Nutzung überführt werden, wie Blühwiesen, Extensivgrünland oder Streuobstwiesen.
- Grünflächen innerhalb von Siedlungsgebieten: Auch in städtischen oder peri-urbanen Bereichen können Flächen als Ausgleich geschaffen werden, beispielsweise durch die Begrünung von Dächern, die Anlage von Parks oder die Pflanzung von Bäumen in städtischen Gebieten.
- Ausgleichsflächen durch Aufforstung: In einigen Fällen kann die Aufforstung von Brachflächen (ehemaliger Wald) oder landwirtschaftlich genutztem Land als Ausgleich dienen. Dies kann besonders in Regionen mit hoher Entwaldung zur Verbesserung der CO2-Bilanz und des Klimaausgleichs beitragen.
Anforderungen an Ausgleichsflächen
Die Anforderungen an Ausgleichsflächen richten sich nach den Zielen, den Eingriffen in die Natur und der biologischen Vielfalt sowie dem Erhalt der ökologischen Funktionen. Die wichtigsten Anforderungen an die Ausgleichsflächen sind:
- Ökologische Gleichwertigkeit: Die Ausgleichsflächen müssen in ihrer ökologischen Funktion den betroffenen Flächen entsprechen. Das heißt, dass sie mindestens denselben ökologischen Nutzen wie die durch das Bauvorhaben beeinträchtigten Flächen bieten müssen (z. B. in Bezug auf die Artenvielfalt oder den Lebensraum für Tiere und Pflanzen).
- Langfristigkeit und Nachhaltigkeit: Ausgleichsflächen sollten langfristig gesichert werden. Das bedeutet, dass sie dauerhaft erhalten und nicht durch spätere Bauvorhaben oder intensive Nutzung gefährdet werden. Oft wird eine langfristige Verpflichtung zur Pflege und Entwicklung der Flächen vertraglich festgelegt.
- Geeignetheit der Fläche: Die ausgewählten Ausgleichsflächen müssen für den vorgesehenen ökologischen Ausgleich geeignet sein. Also muss diese die nötigen Bedingungen bieten, um eine positive ökologische Entwicklung zu ermöglichen (z. B. geeignete Bodenverhältnisse oder den richtigen Wasserhaushalt für bestimmte Pflanzen- und Tierarten).
- Anpassung an den regionalen Kontext: Ausgleichsflächen sollten in der Nähe des Eingriffsgebietes liegen, damit die ökologischen Vernetzung gefördert wird und ein regionaler Ausgleich geschaffen werden kann. In seltenen Fällen können sie jedoch auch außerhalb der Gemeinde oder des unmittelbarn Einzugsgebiets liegen, wenn dies ökologisch sinnvoller ist.
- Vielfalt der Ökosysteme: Es sollte auf die Schaffung einer Vielzahl von unterschiedlichen Lebensräumen geachtet werden, um eine hohe biologische Vielfalt zu fördern. Dies kann die Schaffung von Feuchtgebieten, Wälderm, Wiesen oder anderen naturnahen Lebenräumen beinahlten.
- Pflege und Entwicklung: Ausgleichsflächen müssen regelmäßig gepflegt und weiterentwickelt werden, damit ihre ökologische Funktionalität langfristig erhalten bleibt. Dazu gehört ewta das Entfernen invasiver Arten, die Pflege von Gehölzen oder die Konrolle des Wasserhaushalts.
- Monitoring und Erfolgskontrolle: Es ist wichtig den Erfolg der Ausgleichsmaßnahmen zu überwachen. Dabei soll die Erfüllung der gewünschten ökologischen Funktionen der Ausgleichsflächen sichergestellt werden. Dadurch können gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden.
- Integration in das Landschaftsbild: Die Ausgleichsflächen sollten in das Landschaftsbild integriert werden, sodass sie die lokale Natur unterstützen und nicht isoliert wirken. Dabei wird die Vernetzung von Lebensräumen gefördert. Zudem hilft dies die biologische Vielfalt über größere Gebiete hinweg zu erhalten.
Wer kauft und braucht eine Ausgleichsflächen?
Ausgleichsflächen werden in der Regel von verschiedenen Akteuren benötigt und erworben, welche auf verschiedene Weisen in natureingreifende Projekte involviert sind. Die häufigsten Erwerber und Nutzer solcher Flächen sind:
- Bauunternehmen und Projektentwickler: Bei größeren Bauprojekten (z. B. dem Bau von Wohnsiedlungen, Gewerbegebieten, Straßen oder Infrastrukturprojekten) wird häufig eine Ausgleichfläche benötigt, um die ökologischen Auswirkungen des Projekts auszugleichen. Bauträger müssen dann Ausgleichsflächen kaufen oder bereitstellen, sodass die gesetzlichen Anforderungen zum ökologischen Ausgleich erfüllt werden.
- Kommunen und Städte: Besonders wenn städtebauliche Entwicklungen oder Infrastrukturprojekte (wie Straßenbau oder Industrieansiedlungen - Neuausweisung von Gewerbe- und Industrieflächen) geplant werden, benötigen Städte und Gemeinden eine Ausgleichsfläche. Diese kaufen oder pachten Ausgleichsflächen, damit die ökologischen Anforderungen für die Entwicklung von neuen Baugebieten erfüllt wird.
- Landwirte und private Grundstückseigentümer: Manchmal werden landwirtschaftliche Flächen oder private Grundstücke als Ausgleichsflächen genutzt. Eigentümer solcher Flächen können diese entweder selbst für ökologische Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stellen oder sie verkaufen bzw. verpachten diese an Projekt-Entwickler, Bauträger oder staatliche Stellen.
- Naturschutzorganisationen: Naturschutzorganisationen oder Stiftungen kaufen Ausgleichsflächen, um Naturschutzprojekte zu unterstützen, welche beispielsweise die Wiederherstellung von Lebensräumen oder die Förderung der Biodiversität betreffen. Diese Flächen können dann langfristig geschützt und gepflegt werden.
- Regierungsbehörden und staatliche Stellen: In vielen Fällen übernimmt der Staat selbst den Erwerb von Ausgleichsflächen, besonders wenn es um ein landesweites oder regionales Netzwerk von Schutzgebieten oder die Schaffung von Renaturierungsprojekten geht. Diese Flächen dienen dem ökologischen Ausgleich oder der Verbesserung des Naturhaushalts.
- Unternehmen und Industrien: Unternehmen, welche durch ihre Aktivitäten (z. B. Bergbau-, Energie- oder Transportbranche) die Umwelt beeinflussen, müssen ebenfalls Ausgleichsflächen erwerben, damit die gesetzlichen Umweltauflagen erfüllt werden. Diese Flächen werden in der Regel für die Kompensation von Eingriffen in die Natur durch industrielle Aktivitäten benötigt.
- Planer und Umweltberater: In vielen Fällen sind Umweltplaner oder Berater in den Vorgang der Ausgleichsflächenentwicklung eingebunden. Diese können für Bauunternehmen oder Kommunen Flächen suchen und koordinieren, welche den ökologsichen Anforderungen des Projekts entsprechen.
- Die Bahn: Für Neubau oder Erweiterung von Bahnstrecken
Was ist eine ökologische Aufwertung und wozu braucht man diese?
Intensiv genutzte Flächen (z. B. Äcker für die Lebensmittelproduktion) bieten der Natur nur wenig Wert. Wenn man jedoch beispielsweise einen Acker in eine Wiese mit vielen verschiedenen Pflanzenarten umwandelt, wird die Fläche ökologisch deutlich wertvoller und kann so einen Eingriff in die Natur ausgleichen.
Die genau Bewertung solcher Flächen regelt die Bayerische Kompensationsverordnung (in Bayern). Dabei wird ein Biotopwertpunkt-Verfahren angewendet, bei welchem bestimmte Flächen nach ihrer ökologischen Bedeutung eingestuft werden. Besonders wertvoll sind etwa intakte Moorwälder, welche als Lebensräume für viele Tiere und Pflanzen dienen und zusätzlich CO2 speichern. Im Vergleich hierzu bringen konventionell genutzte Ackerflächen nur wenig Punkte.
Idealerweise sollten Ausgleichsflächen Teil eines Biotopverbundes sein. Dieser Verbund, welcher aus miteinander verbundenen, ökologisch wertvollen Flächen besteht, ist wichtig für den Klima- und Artenschutz. Daher sind solche Biotopverbindungen auch im Flächennutzungsplan verankert, wodurch Kommunen passende Ausgleichsflächen leichter finden können.
Quelle für diverse Details: https://rosenheim.bund-naturschutz.de/ortsgruppen/tuntenhausen/ausgleichsflaechen
Warum werden Ausgleichsflächen als Problem angesehen?
Landwirte, die Teile der eigenen Grundstücks-Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stellen, dürfen dieses Ackerland oder Wiesen nicht mehr wie zuvor intensiv bewirtschaften. Das heißt, dass ihm ein Teil oder sogar die gesamte Fläche für die Bewirtschaftung und Einkommen aus der Landwirtschaft verloren geht. In Zeiten, in denen landwirtschaftliche Flächen immer knapper werden und die Preise für den Kauf oder die Pacht steigen, kann das für Landwirte ein ernstes Problem darstellen. Viele von ihnen geben ihre Flächen deshalb nachvollziehbarerweise nur ungern auf.
Investoren und Bauherren, welche Ausgleichsflächen für ihre Projekte benötigen, bieten oft deutlich höhere Preise als den wirklichen Verkehrswert bzw. Marktpreis für die landwirtschaftlichen Grundstücke. Das führt zu weiteren Steigerungen der Grundstückspreise, was von Experten als problematisch angesehen wird. Die Förderung der Landwirtschaft und die regionale Lebensmittelproduktion ist für uns alle wesentlich.
Wer überprüft, ob die Ausgleichsflächen nach den Vorgaben angelegt und gepflegt werden?
Eine Untersuchung im Landkreis Ebersberg im Jahr 2021 zeigte, dass die Hälfte der als "Ausgleichsflächen" angegebenen Flächen entweder gar nicht oder nur unzureichend aufgewertet wurden und weitgehend wie vorher genutzt wurden. Das ist ein Problem, welches vermutlich nicht nur in Ebersberg sondern auch in allen Landkreisen München; Miesbach, Rosenheim und Starnberg vorkommen kann.
Für die Kontrollen sind grundsätzlich die Gemeinden verantwortlich. Wenn festgestellt wird, dass eine Ausgleichsfläche nicht ordnungsgemäß aufgewertet wurde, kann der Bauherr, der die Fläche für sein Projekt angegeben hat, zu einer finanziellen Nachzahlung verpflichtet werden.
Was ist ein Ökokonto?
Gemeinden haben die Möglichkeit, Flächen für künftige Ausgleichsmaßnahmen zu kaufen. Diese Flächen können in einem sogenannten Ökokonto gespeichert werden, wobei sie auch verpachtet werden können. Wenn später für ein gemeindliches Bauvorhaben Ausgleichsflächen benötigt werden, können diese Flächen genutzt werden. Falls die Flächen bereits vor der Nutzung ökologisch aufgewertet werden, bekommt die Gemeinde dafür sogenante "Ökopunkte". Diese Punkte kann sie entweder für zukünftige Projekte verwenden oder für später ansparen. Auch Landwirte haben die Möglichkeit ihre eigenen Flächen aufzuwerten und so Ökopunkte zu sammlen, die sie dann verkaufen können.
Planung und Verfahren einer Ausgleichsfläche
Die Planung und Ausführung einer Ausgleichsfläche erfolgt in mehreren Schritten, welche sowohl rechtliche, ökologische als auch praktische Aspekte berücksichtigt. Die allgemeinen Schritte des Vorgangs sind:
1. Feststellung des Bedarfs:
Zuerst wird im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ermittelt, ob und in welchem Umfang eine Ausgleichsfläche benötigt wird. Das geschieht meistens im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Bauprojekte oder andere Eingriffe in die Natur. Die betroffene Fläche muss auf ihre ökologischen Auswirkungen überprüft werden, damit der erforderliche Umfang des Ausgleichs festgestellt werden kann. Details finden sich auch oft im Flächennutzungsplan.
2. Standortwahl:
Der Standort der Ausgleichsfläche wird anhand folgender Faktoren gewählt:
- Nähe zum Eingriffsgebiet: Der Ausgleich sollte möglichst nah am Eingriffsort (Neubauort) erfolgen, sodass die ökologische Vernetzung der Landschaft gefördert wird.
- Eignung der Fläche: Die Fläche muss geeignet sein, um die geplanten ökologischen Ziele zu erreichen. Hierbei werden beispielsweise die Bodenverhältnisse, die klimatischen Bedingungen und die Möglichkeiten der nachhaltigen Bewirtschaftung und Renaturierung berücksichtigt. Auch können Bodengutachten hierfür notwendig sein.
- Biotopverbund: Die Fläche sollte am Besten Teil eines Biotopverbundes sein, sodass die Vernetzung von Lebensräumen gewährleistet wird.
3. Planung der Aufwertungsmaßnahmen:
Die konkrete Planung der Ausgleichsmaßnahmen umfasst:
- Ökologische Aufwertung: Dies kann die Umwandlung von intensiven landwirtschaftlichen Flächen in naturnahe Lebensräume (z. B. Feuchtgebiete, Wiesen oder Wälder) umfassen. Auch die Anpflanzung von Hecken oder Bäumen kann Teil der Aufwertung sein.
- Renaturierung: Bei stark beschädigten oder veränderten Landschaften kann eine Renaturierung notwendig sein, damit die Fläche wieder in ihren natürlichen Zustand versetzt wird.
- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen: Die Fläche muss regelmäßig gepflegt werden, um die gewünschten ökologischen Ziele zu erreichen. Dazu gehören Maßnahmen wie das Entfernen von invasiver Arten oder die Pflege von Pflanzen.
4. Genehmigung und rechtliche Rahmenbedingungen:
Die geplante Ausgleichsfläche muss oft von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Hierbei sind Umweltgesetze und -verordnungen zu beachten, wie die Bayerische Kompensationsverordnung oder das Bundesnaturschutzgesetz. Auch Flächennutzungspläne und andere städtebauliche Vorgaben müssen eventuell berücksichtigt werden.
5. Ökopunkte und Verwertung:
Im Falle von ökologischen Aufwertungsmaßnahmen können "Ökopunkte" generiert werden, welche der Gemeinde oder dem Landwirt als Nachweis für die erfolgreich durchgeführten Maßnahmen dienen. Diese Punkte können später für andere Projekte genutzt oder verkauft werden.
6. Durchführung und Umsetzung:
Nach der Planung werden die notwendigen Maßnahmen umgesetzt. Dies umfasst die tatsächliche Aufwertung der Fläche, die Pflege der Flächen sowie die Kontrolle, ob die Aufwertung den gewünschten ökolgischen Erfolg hat.
7. Kontrolle und Monitoring:
Nach der Umsetzung muss die Ausgleichsfläche regelmäßig überprüft werden, damit das Erreichen der ökologischen Ziele sichergestellt werden kann. Diese Kontrollen erfolgen meist durch die zuständigen Behörden oder durch beauftragte Fachleute. Wird ein Defizit festgestellt, müssen gegebenenfalls Nachbesserungen vorgenommen werden.
8. Langfristige Pflege und Nachverwaltung:
Die Ausgleichsfläche muss langfristig gepfegt werden, sodass die ökologischen Funktionen erhalten bleiben. Das kann auch Nachverwertung von Ökopunkten umfassen, wenn die Fläche nicht mehr benötigt wird oder in anderen Projekten genutzt wird.
Kosten - qm Kaufpreise für Grundstücke als Ausgleichsfläche
Die Kosten für die Erstellung und Pflege von Ausgleichsflächen können je nach Art, Umfang und Standort der Maßnahme stark variieren. Die wichtigsten Kostenfaktoren, die bei der Planung und Umsetzung von Ausgleichsflächen sind:
Kosten für den Erwerb der Fläche:
- Kaufpreis: Wenn die Gemeinde oder ein privater Bauherr die Fläche kaufen muss, fallen in der Regel erhebliche Anschaffungskosten an, insbesondere in Regionen mit hohem Bodenwert. Die Preise hängen vom Standort, der Größe der Fläche und der Nutzung der benachbarten Flächen ab.
- Eine Information über qm Kaufpreise für öffentlich angebotene landwirtschaftliche Flächen in ca. 170 Gemeinden seit dem Jahr 2005 in den Landkreisen München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach. Starnberg und Traunstein haben wir Ihnen hier aufgeführt:
- Pachtkosten: Falls die Grundstücksfläche gepachtet wird, entstehen jährliche Pachtkosten, welche je nach Region und Art der Fläche variieren können. Die durchschnittlichen Pachtpreise für landwirtschaftliche Grundstücke in Bayern finden Sie hier
Kosten für die Planung:
- Ökologische Bewertung: Vor der Umsetzung müssen Fachleute die Fläche begutachten, um festzustellen, welche ökologischen Aufwerungsmaßnahmen notwendig sind. Diese Bewertung und die daraus resultierenden Planungen müssen häufig von Umweltexperten oder Planungsbüro durchgeführt werden.
- Genehmigungsgebühren: Für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen sind oft Genehmigungen erforderlich, deren Kosten ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
Kosten für die Aufwertung der Fläche:
- Renaturierungskosten: Wenn die Fläche renaturiert werden muss, sind die Kosten für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu berücksichtigen. Das kann beispielsweise das Anlegen von Gewässern, das Entfernen von Drainagesystemen oder das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern umfassen.
- Umwandlungskosten: Wenn eine landwirtschaftliche genutzte Fläche in eine naturnahe Wiese oder einen Wald umgewandelt werden muss, entstehen ebenfalls Kosten für den Anbau von Pflanzen, Bäumen oder Gräsern sowie für die Bodenaufbereitung.
- Materialkosten: Für die Aufwertung werden oft spezielle Materialien wie Saatgut, Pflanzen, Baumsetzlinge oder Geotextilien benötigt.
Pflege- und Bewirtschaftungskosten:
- Regelmäßige Pflege: Die Pflege der Fläche ist entscheidend, damit der ökologische Erfolg gewährleistet wird. Dazu gehören Maßnahmen wie das Mähen von Wiesen, die Entfernung von invasiven Pflanzen, die Pflege von Hecken oder das regelmäßige Bewässern von neu gepflanzten Bäumen.
- Langfristige Pflege: Auch nach der Aufwertung müssen Ausgleichsflächen oft über Jahre oder Jahrzehnten gepflegt werden, um die ökologische Funktion zu erhalten. Diese langfristigen Pflegekosten müssen ebenfalls einkalkuliert werden.
Kosten für Monitoring und Erfolgskontrollen:
- Überwachung und Dokumentation: Es entsteht Kosten für die regelmäßige Kontrolle und Dokumentation des Erfolgs der Aufwertungsmaßnahmen. Dazu gehört das Monitoring von Flora und Fauna, sodass das Erreichen der Ziele der Ausgleichsmaßnahmen sichergestellt werden kann.
- Gutachterkosten: In einigen Fällen sind externe Gutachter erforderlich, damit die ökologischen Ergebnisse überprüft werden und gegebenenfalls Nachbesserungen vorgenehmen werden.
Verwaltungskosten:
- Verwaltung und Dokumentation: Sowohl Gemeinden als auch private Bauherren müssen Verwaltungsaufwand betreiben, um Ausgleichsflächen korrekt zu dokumentieren, Ökopunkte zu sammeln und rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Diese administrativen Aufgaben verursachen ebenfalls Kosten.
Ersatzgelder:
Falls eine Ausgleichsmaßnahme nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird oder nicht den Anforderungen entspricht, können Ersatzgelder vom Bauherrn (Bauträger / Projektentwickler / Infrastrukturinvestor) verlangt werden. Diese Zahlungen müssen in den Gesamtkosten eingeplant werden, falls es zu Verzögerungen oder Defiziten kommt.
Beispiele für Grundstücke mit Ausgleichsmaßnahmen
Ausgleichsmaßnahmen dienen dazu, die negativen Auswirkungen von Eingriffen in die Natur auszugleichen und den ökologischen Wert von Flächen zu erhöhen.
Beispielsweise:
Renaturierung von Feuchtgebieten:
- Maßnahme: Die Wiederherstellung von Mooren, Sumpflandschaften oder anderen Feuchtgebieten, die durch Trockenlegung oder Bebauung stark beeinträchtigt wurden.
- Ziel: Diese Maßnahmen fördern die Wiederherstellung der natürlichen Hydrologie und bieten Lebensräume für seltene Pflanzen- und Tierarten wie z.B. Amphibien oder Vögel.
Umwandlung von Ackerflächen in artenreiche Wiesen:
- Maßnahme: Landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen werden in extensiv genutzte Wiesen oder Blumenwiesen umgewandelt, die eine hohe biologische Vielfalt aufweisen.
- Ziel: Förderung der Artenvielfalt, insbesondere von Insekten wie Bienen und Schmetterlingen, die auf Blühpflanzen angewiesen sind.
Anplanzung von Hecken und Gehölzen:
- Maßnahme: Schaffung von Hecken, Baumreihen oder kleineren Waldflächen entlang von Feldern, Straßen oder Gewässern.
- Ziel: Verbesserung der Lebensräume für Vögel, Insekten und Kleintiere sowie Förderung der ökologischen Vernetzung (Biotopverbund). Hecken dienen auch als Wind- und Erosionsschutz.
Renaturierung von Gewässern:
- Maßnahme: Die Wiederherstellung von natürlichen Gewässerstrukturen, z.B. das Freilegen von Bächen oder die Schaffung von Flachwasserbereichen in Teichen und Seen.
- Ziel: Verbesserung der Wasserqualität, Schaffung von Lebensräumen für Wasserpflanzen, Fische und Amphibien sowie Förderung der natürlichen Fließdynamik.
Aufforstung und Waldumbau:
- Maßnahme: Aufforstung von Flächen oder der Umbau bestehender Wälder zu naturnahen, biodiversitätsfördernden Wäldern.
- Ziel: Förderung der Biodiversität, Verbesserung des Klimaschutzes durch CO2-Speicherung und Schaffung stabiler Ökosysteme. Besonders wertvoll sind naturnahe Mischwälder im Gegensatz zu Monokulturen.
FAQ - Häufig gestellte Fragen:
Was darf man auf Ausgleichsflächen machen?
Auf Ausgleichsflächen darf man nur die Maßnahmen durchführen, die zur ökologischen Aufwertung vorgesehen sind, z.B. Pflanzen oder pflegen.
Wann müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden?
Ausgleichsflächen müssen geschaffen werden, wenn ein Eingriff in die Natur (z.B. Bauprojekte) unvermeidbar ist. Die Baubehörden kümmern sich im Bauleitplanungsverfahren um die Bedarfsanalyse von notwendigem Grundstücksflächenbedarf.
Was sind Ausgleichsflächen wert - Kaufpreise pro qm?
Der Wert einer Ausgleichsfläche hängt von ihrer ökologischen Qualität und den Ökopunkten ab, die sie generiert. Ferner ist der Standort des Grundstücks sowie der Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Grundstücke relevant. Die Preisentwicklung für landwirtschaftliche und Baugrundstücke in ca. 170 Gemeinden und Stadtteilen in München und den Landkreisen München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach und Traunstein finden Sie hier Grundstückspreise
Wer pflegt Ausgleichsflächen?
Die Pflege übernehmen in der Regel die Eigentümer der Fläche, wie Gemeinden oder gewerbliche sowie private Bauherren. Oftmals sind auch Naturschutzauflagen oder Landschaftsschutzgebietsauflagen zu beachten.
Können Ausgleichsflächen verkauft werden?
Ja, Ausgleichsflächen können verkauft oder verpachtet werden, wenn die ökologischen Ziele erfüllt sind. Der qm Preis einer "verbrauchten" Ausgleichsfläche liegt erfahrungsgemäß zwischen 0,10- bis 5 Euro / qm, da diese nur wenig nutzbaren Wert für den Käufer hat. Eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist ja ausgeschlossen.
Wer kontrolliert Ausgleichsflächen?
Die Gemeinden, Städte oder zuständigen Behörden kontrollieren, ob Ausgleichsflächen ordnungsgemäß aufgewertet werden.
Wie viel Geld bekommt man für Ausgleichsflächen?
Der Preis für Ausgleichsflächen hängt von der Größe, Lage und den ökologischen Werten ab. Gerne können wir Ihnen im Raum München, Ebersberg, Rosenheim, Traunstein, Starnberg, Miesbach bei der Preisfixierung und dem Verkauf Ihres Grundstücks weiterhelfen.
Wann dürfen Ausgleichsflächen gemäht werden?
Ausgleichsflächen dürfen in der Regel erst dann gemäht werden, wenn die Aufwertungsmaßnahmen abgeschlossen und die ökologischen Ziele erreicht sind.
Wer legt Ökopunkte fest?
Ökopunkte werden von Fachgutachtern oder zuständigen Behörden anhand des Biotopwertpunktverfahrens festgelegt.
Wie viele Ökopunkte bekommt man pro qm Ausgleichsfläche?
Die Anzahl der Ökopunkte pro m² hängt von der Art der Fläche und der durchgeführten Aufwertungsmaßnahme ab.
Wie viel sind Ökopunkte wert?
Der Wert von Ökopunkten variiert und wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt, z.B. bei der Verwertung für andere Projekte.
Was bedeutet eine peri-ubane oder suburbane Stadt ?
Eine peri-urbane oder suburbane Stadt liegt am Rand einer Kernstadt und verbindet städtische mit ländlichen Strukturen. Sie ist oft durch Wohngebiete, geringere Bebauungsdichte und Pendlerverbindungen geprägt.
Was ist die Bayerische Kompensationsverordnung für Ausgleichsflächen und wo finde ich diese?
Die Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) regelt den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft durch Ausgleichsflächen oder Ersatzmaßnahmen. Sie ist im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht und online unter gesetze-bayern.de abrufbar.
Gibt es Immobilienmakler für Ausgleichsflächen?
Direkt nicht, aber jeder Makler, der als Sachverständiger für Wald, Wiesen, Forst, Ackerland und Spekulationsgrundstücke bzw. Bauerwartungsland agiert, kann Ihnen beim Verkauf Ihrer landwirtschaftlichen Flächen weiterhelfen. Oder er hilft Ihnen, beim Erwerb von Ausgleichsflächen, da er Verkäufer von Wald und Wiesenflächen kennt. Gerne können Sie uns im Raum München und Oberbayern hier ansprechen.